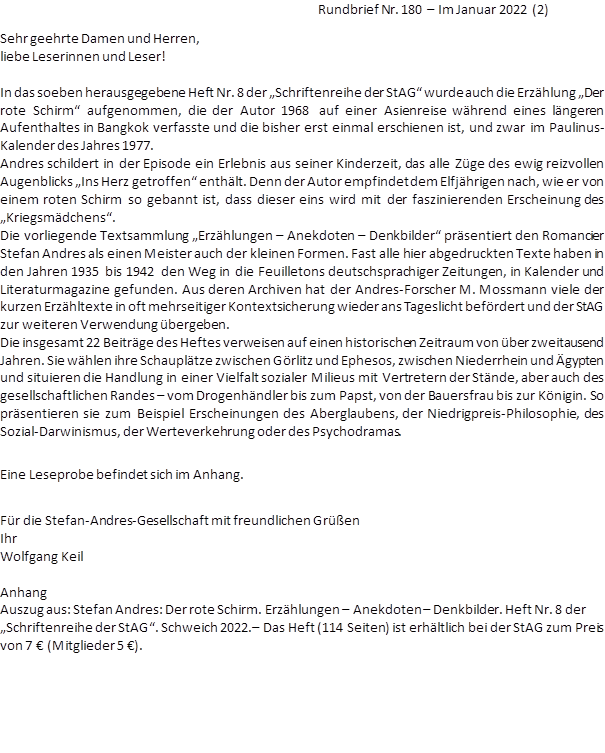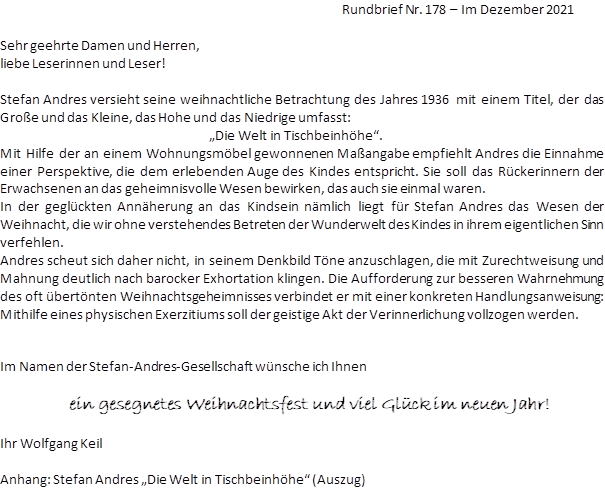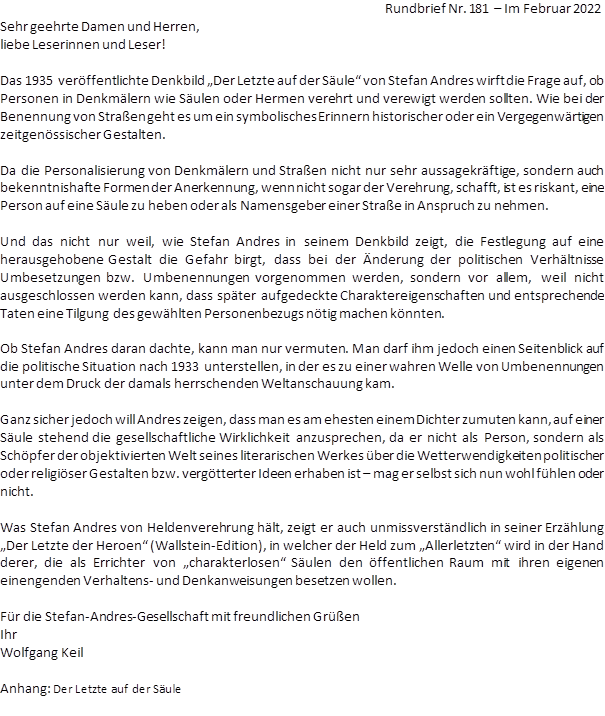
Rundbrief Nr. 180 – Im Januar 2022
Rundbrief Nr. 179 – Im Januar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser!
In seiner Erzählung „Die beiden Pharaonen“ („Positano. Geschichten aus einer Stadt am Meer“, 1957) schildert Stefan Andres die Aktivitäten des Urlaubers Bouterwek, eines sehr deutschen Besuchers von Positano in prätouristischer Zeit.
Der Mitteleuropäer Bouterwek hat sich vorgenommen, den südlichen Ort seiner von Nietzsches „Zarathustra“ beeinflussten kruden Allmachtsvorstellung zu unterwerfen und das verschlafene Nest dabei zugleich in die rational-wissenschaftlich orientierte Neuzeit zu katapultieren. Seine erste Tat besteht daher sowohl symbolisch als auch realiter in der Anpassung des malerischen Küstenortes an die allgemein gültige, zuverlässige und korrekte Zeitrechnung, die er mit der Reparatur der Uhr am Campanile des Doms von Positano herbeiführen lässt. Da er dies auf eigene Rechnung tut und weil sein weißer Anzug Respekt heischt, nennen ihn die Positanesen fast ehrfurchtsvoll „Signor Barone“.
In einem weiteren Modernisierungsschritt nimmt Bouterwek die hygienischen Verhältnisse des verträumt-säumigen Bergstädtchens in Angriff. Seine Kampagne gipfelt im Aufruf zu einer Impfaktion, von der vor allem die Kinder profitieren sollen. Das Echo ist nicht ganz ungeteilt.
Die von Andres verfolgte Erzählabsicht bringt es mit sich, dass die aktuell anmutende Impf-Episode zur anschaulichen Schilderung des Milieus und der unterschiedlichen Mentalitäten gerät. Dabei wahrt der „Lokalchronist“ eine ironisch-heitere Balance, mit der er – jegliche plumpe Parteinahme meidend – ebenso einfühlsam wie kritisch die beiderseitigen Vorstellungen und Belange austariert.
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen und
mit den besten Wünschen für das Jahr 2022!
Ihr
Wolfgang Keil
Anhang: „Die beiden Pharaonen“ (Auszug) und ein aktueller Lektürehinweis.
Rundbrief Nr. 178 – Im Dezember 2021
Rundbrief Nr. 177 – Im November 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Mit den Sittenbildern „Die Erben des Lebens“ (1943/4) und „Rom, im Jahre 1595“ (1940) hat sich Stefan Andres eines literarischen Mediums bedient, das zu einer kritischen Betrachtung der Zeitumstände im Rom des 16. Jahrhunderts auffordert. Die Manifestation des Niedergangs päpstlicher Gesittung und Gesinnung, offenbart im Exzess der Gewalt und im Verstoß gegen Jesu Abschiedsworte „ut omnes unum sint“, verbindet die bekenntnishaften Darstellungen. Deren thematische Nachbarschaft wird betont durch die gleich oder ähnlich lautenden Bezeichnungen der jeweiligen Handlungsträger.
In „Die Erben des Lebens“ schildert Andres, wie unter Papst Julius II. vor allem Adelige wegen ihres oft sehr freizügigen Lebenswandels hingerichtet werden. Der Geruch ihrer auf der Engelsbrücke zur Mahnung ausgestellten Leichen durchdringt das Geschehen.
In „Rom, im Jahre 1595“ (Auszug im Anhang) ist der Zerfall der Sitten so weit vorangeschritten, dass der Briefschreiber Ludovico seinem Freund Huosi im fernen Osten gestehen muss, Rom sei nicht mehr der Ort, von dem die mater ecclesia ihre christliche Botschaft ausstrahle. Trost und Hoffnung könnten nur noch aus Huosis eben erst missioniertem Land kommen. Rom dagegen liefere den Beweis, dass mit dem Schwert die Gewalt an die Stelle des Rechtes getreten und der Papst derart in diese Welt verstrickt sei, dass er in feiger Weise die Prinzipien einer christlichen Weltordnung verrate, indem er eine „unheilige“ Allianz mit verbrecherischen Aristokraten eingehe.
Ludovico wird daher seine Reise in das Land der aufgehenden Sonne nicht mit dem Missionsorden der Societas Jesu antreten, sondern im Auftrag der päpstlichen Curie, die „bis an die Grenzen der Erde“ zu gehen bereit sein muss – jedoch paradoxerweise nicht, um dort die christliche Botschaft zu verkünden, sondern, um sich im fernen Asien überhaupt erst wieder ihres eigenen Glaubens und Heils zu vergewissern.
Stefan Andres: Die Erben des Lebens. In: Terrassen im Licht. Italienische Erzählungen. Hg. Dieter Richter. Göppingen 2009.
Stefan Andres: Rom, im Jahre 1595. Rom 1940. Ineditum. Typoskript im Archiv der Stefan-Andres-Gesellschaft Schweich.
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 176 – Im Oktober 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Mit mehr als einjähriger Verzögerung konnte am 19. September dieses Jahres der Stefan-Andres-Preis der Stadt Schweich an den renommierten Schriftsteller Norbert Scheuer überreicht werden. In einer musikalisch begleiteten Feier in der ehem. Synagoge Schweich, an der wegen Corona nur fünfzig Gäste teilnehmen konnten, übergab Stadtbürgermeister Lars Rieger die Urkunde (Anhang), in der die Preisvergabe begründet ist, an den erfolgreichen Romancier aus Kall in der Nordeifel, dessen Werk mittlerweile auf acht Romane sowie Erzähl- und Lyrikbände angewachsen ist.
In seiner Einführung würdigte Stadtbürgermeister Lars Rieger die Europäer Stefan Andres und Norbert Scheuer, während Dr. Claude Conter, Leiter der Nat. Bibliothek Luxemburg, in seiner Laudatio das Werk des Preisträgers einer literaturwissenschaftlichen Analyse und Interpretation unterzog. Norbert Scheuer extemporierte seine Dankesrede mit Bezug auf seine Arbeit und die Ausführungen des Laudators. Abschließend hob Wolfgang Keil den Forum-Charakter der literarischen Werke von Andres und Scheuer hervor.
Die Verleihungsfeier zeigte, dass viele Wege zum Werk von Stefan Andres führen. Die Preisvergabe an den Erfolgsautor Norbert Scheuer ließ auch Stefan Andres im Licht des aktuellen Zeitgeschehens erscheinen.
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Anhang: Wortlaut des Begründungstextes der Verleihungsurkunde
Rundbrief Nr. 175 – Im September 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Stefan Andres und Norbert Scheuer begegnen einander nicht nur am entlegenen Hindukusch in Afghanistan (Rundbrief Nr. 173) und im Trierer Dom (Rundbrief Nr. 174), sondern auch am einsamen Walden Pond bei Concord, Massachusetts.
In der relativen Zivilisationsferne dieses Sees hat sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts Henry D. Thoreau angesiedelt, um sein Leben ganz dem Walten der Natur anzupassen. Sein Experiment in „essential living“ schildert er in dem Essayband „Walden oder Leben in den Wäldern“ („Walden, or, Life in the Woods“), der 1854 veröffentlicht wurde. Während Thoreaus Schrift „Vom zivilen Ungehorsam“ („On the Duty of Civil Disobedience“) nach Gandhis Übernahme der Methode des passiven Widerstandes in viele freiheitlichen Bewegungen hineingewirkt hat, blieb der zivilisationskritische Bericht vom „Walden Pond“, in dem Natur, Gefühl und geistige Erfahrung zu einem Ganzheitserlebnis der unschwärmerischen Mystik Thoreaus zusammenfließen, eher im Hintergrund des öffentlichen Bewusstseins.
Nicht so allerdings bei Stefan Andres und Norbert Scheuer. Diese Schriftsteller interessiert das Leben in der Stille und Abgeschiedenheit des Walden-Sees so sehr, dass sie es zum Gegenstand ihres Schreibens machen. Stefan Andres würdigt Thoreau in seinem Essay „Henry David Thoreau, der Eremit von Walden Pond“. Darin wirken manche Gedanken wie vorweggenommene Fußnoten zu Norbert Scheuers Roman „Die Sprache der Vögel“, in welchem sich der Protagonist Paul Arimond ausdrücklich auf den amerikanischen Philosophen bezieht: Jetzt lese ich Thoreau und verstehe vieles anders als früher, viel besser glaube ich.
Stefan Andres schätzt in dem „seltsamsten aller Amerikaner“ den Naturmystiker, von dem er schreibt: Er kannte das Kragenwaldhuhn, wechselte mit der Bisamratte Blicke und redete mit dem Murmeltier jene ekstatische Ur-Sprache, die alles mit allem verbindet. Dem entspricht bei Norbert Scheuer Paul Arimonds Überlegung zur Kommunikation der Vögel: Ich lehne mit dem Rücken am Geländer, höre einen Sumpfrohrsänger trillern und stelle mir vor, wie er während seiner Wanderschaft viele andere Vogelsprachen lernt, alle Sprachen jener Länder, durch die er zieht – ein polyglotter kleiner Gesangskünstler.
Nach Stefan Andres erreicht der Naturmystiker das Ziel seiner Bestrebungen, wenn er in die zivilisationsenthobene Ruhe der Schöpfung eingeht: … wo die Person aufhörte und ihren Punkt auf der kreisenden Scheibe der Erscheinungen aufgab und in die Mitte geriet, wo alles stille stand, wo die Ruhe war und also der Ursprung der Bewegung. Ähnlich empfindet das der Protagonist Paul Arimond in „Die Sprache der Vögel“: … ich habe das Gefühl, als würde die Zeit stillstehen und zugleich rasend schnell vergehen, wie in einem herumwirbelnden Karussell, in dessen Zentrum ich in einem Schwebezustand lebe. – Daher wohl Pauls Wunsch: Ich wollte eine Elster sein.
Norbert Scheuer: Die Sprache der Vögel. Roman. München 2015.
Stefan Andres: Henry D. Thoreau, der Eremit von Walden Pond. In: Stefan Andres: Der Dichter in dieser Zeit.
Stefan Andres: Reden und Essays. Hg. Chr. Andres und M. Braun. Göttingen 2013.
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 174 – Im August 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Nicht nur im ewigen und aktuellen Afghanistan begegnen sich Stefan Andres und Norbert Scheuer (Rundbrief Juli) mit ihren Werken, sondern auch im Trierer Dom – möglicherweise sogar auf ein und derselben Bank. Dabei versetzen die beiden Schriftsteller ihre jeweiligen Protagonisten in völlig verschiedene Lebensumstände und Situationen, bei Stefan Andres geprägt von feierlicher Erhabenheit und von erbarmenswürdiger Hilflosigkeit bei Scheuer.
In dem Erinnerungsroman „Der Knabe im Brunnen“ von Stefan Andres, macht der kleine Steff mit seiner Mutter einen Beichtbesuch im Trierer Dom. Während sie dort in einer Seitenkapelle gemeinsam ihre Butterbrote verzehren, reift in dem Siebenjährigen der Entschluss, das Amt des Weihbischofs, das er mittlerweile höher schätzt als das eines Bischofs, anzustreben und diesem Vorhaben seine Freundin Kätta zu opfern. In dieser Absicht findet er sich durch die Kirchlichkeit und Frömmigkeit der Atmosphäre bestärkt:
Die Heiligen auf den Altären hatten einen Ausdruck in den Augen, der dieser Weihrauchluft entsprach. Sie sagten: ‚Was ist Kätta im Vergleich zu uns! Das einzig Wertvolle am Menschen ist seine unsterbliche Seele.‘ Das hatte ich nun gelernt! Sogar der Kaiser Konstantin, der in diesem Hause einmal lebte bei seiner Heiligen Mutter Helena, – sein Wert bestand nur darin, dass er ein Mensch war, eine Seele hatte und sich taufen ließ. Daran gab es keinen Zweifel, obwohl es der Kaplan war, der uns das gelehrt hatte. Meine Gedanken waren von Kätta zur heiligen Helena und ihrem Sohn abgeirrt. Ich kaute mein Butterbrot und dachte an diese beiden, die auch einmal vor vielen hundert Jahren hier nebeneinandergesessen und ihr Brot verzehrt hatten. Nun waren sie in der Ewigkeit!
Zumindest ein Rest kirchlicher Frömmigkeit teilt sich dem Jugendlichen Rosarius Delamot, Protagonist des Romans „Peehs Liebe“ von Norbert Scheuer, an dem erwähnten Ort mit. Er ist aus einem Erziehungsheim im Norden Deutschlands geflüchtet, um nach Hause, nach Kall in der Eifel, zurück zu gelangen. Nach einem schier endlosen Zickzackkurs, der ihn ohne Fahrschein in immer wieder anderen Zügen durch Deutschland verschlägt, landet der völlig Verwahrloste schließlich in Trier und dann auch im ehrwürdigen Dom:
Der Kontrolleur warf mich am nächsten Bahnhof hinaus, gab mir einen Tritt in den Hintern. Ich lief vom Bahnhof in die Stadt. Sie kam mir bekannt vor, ich hatte hier mit Kathy Werbekarten verteilt. Es war August, überall wimmelte es von Touristen und Pilgern. Der Heilige Rock wurde im Dom in einem luftdichten Glasschrein ausgestellt. Ich war müde und blieb auf einer Kirchenbank hocken. Vor mir auf der Bank knieten Leute, die flüsternd beteten. Es kam mir vor, als würden sie ein schönes Lied singen, das mich an zu Hause erinnerte.
Als die Leute den Dom verließen, lief ich hinter ihnen her zum Bahnhof und stieg mit ihnen in einen Regionalzug.
Stefan Andres: Der Knabe im Brunnen. Roman. Hg. Chr. Basten u. H. Erschens. Göttingen 2011.
Norbert Scheuer: Peehs Liebe. Roman. München 2012.
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 173 – Im Juli 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Wenn Norbert Scheuer – wie wir hoffen – zur öffentlichen Verleihung des „Stefan-Andres-Preises für Literatur deutscher Sprache“ im September in Schweich erscheint, dann kommt es zu einer geistigen Begegnung zweier bedeutender Schriftsteller auf einem Boden, den man als Andres-Land bezeichnen kann. Dabei ist es gut zu wissen, dass sich die beiden Schriftsteller schon früher einmal auf literarisch-imaginäre Weise begegnet sind – am Hindukusch im fernen Afghanistan.
In dieses sagenhafte Land führt uns der Reisebericht „Bei den Barfüßern am Hindukusch“, den Stefan Andres nach seiner Asienreise 1968 verfasst hat. Besonders angetan zeigt er sich von der Freundlichkeit und Bedürfnislosigkeit der Menschen am Hindukusch, denen die Wärme der Frühjahrssonne und der Gesang eines Vogels zum Wohlbefinden genügen:
„Dieses kerngesunde, rauhe, aber im Grunde gutmütige Gebirgsvolk kann an Anspruchslosigkeit kaum übertroffen werden. Wenn der Schnee geschmolzen ist oder sich nur irgendwo eine besonnte Hauswand zeigt, nimmt der Afghane nach getaner Arbeit gern seinen Vogelbauer, stellt ihn – wie die Leute bei uns ihren Transistor! – neben sich in die Sonne und hört dem Vogel zu.“
Stefan Andres: Bei den Barfüßern am Hindukusch. Mitteilungen der StAG XIX/1998.
In Norbert Scheuers Roman „Die Sprache der Vögel“ ist der Protagonist Paul Arimond wie sein Urahn Ambrosius Arimond fasziniert vom Artenreichtum der Vogelwelt Afghanistans und von der Schönheit und universalen Kommunikationsweise der Vögel. Deshalb versucht er, ihnen unter Einsatz seines Lebens im militärischen Sperrgebiet näherkommen. Er möchte ihre Sprache erlernen und ihre Lebensweise verstehen – und vielleicht noch etwas mehr:
„Ich weiß nicht, was an diesen Geschichten wahr ist, ob Vater selbst daran geglaubt hat. Jedenfalls liebte er es, uns davon zu erzählen. Hinter dem Hindukusch sei das Land der Vögel, sagte er, es gebe dort vielleicht mehr Vogelarten als in ganz Europa, ja in der ganzen westlichen Welt, das liege am einzigartigen Blau des Himmels.“
„Irgendetwas existiert im Leben, das mehr ist als wir selbst und für das es keine Sprache gibt. Vielleicht liegt darin der Grund, dass Vögel singen.“
Norbert Scheuer: Die Sprache der Vögel. München 2015.
Davon mehr bei der Preisverleihung, die hoffentlich im September stattfinden kann!
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 172 – Im Juni 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Wenige Tage vor dem Geburtstag von Stefan Andres könnte auch die Protagonistin seines Romans „Die Hochzeit der Feinde“ (1947) ihr Wiegenfest feiern.
Es geschieht wohl selten, dass in einem nicht-dokumentarischen Roman ein durch Jahreszahl historisch verankertes Kalenderdatum genannt wird: Die Protagonistin Luise wird „am 14. Juni 1924“ achtzehn Jahre alt. Sie ist also wie Stefan Andres im Jahr 1906 zur – allerdings fiktionalen – Welt gekommen, und zwar nur wenige Tage vor dem am 26. Juni geborenen Verfasser des Romans. (Anhang)
Über die Bedeutung dieser zeitlichen Annäherung der Biographien von Romanverfasser und Romanfigur darf man spekulieren. Sicherlich geht es bei der Altersdatierung nicht vorrangig um die Frage der Volljährigkeit im Sinne des BGB-Paragraphen oder um die dort eigens angeführte „Ehemündigkeit“ – es liegt jedoch nahe, dass der Autor, der sich auch sonst weitgehend mit seiner Romanfigur identifiziert, ein Signal senden möchte, das aufmerksam macht auf die Überwindung der Jugendkrise in der Adoleszenz, auf den Lebensabschnitt also, den er selbst als ein Ringen um die Richtung seines Lebens erfahren hat.
In diesem Stadium der Orientierung trifft die Romanfigur Luise eine Entscheidung, die als Ausdruck eines gefestigten Selbstwertgefühls ihren Lebensplan bestimmen wird. Ihre Entscheidung basiert auf einem Grad von Autonomie, den auch der Autor als die conditio sine qua non seiner eigenen Existenz erachtete.
Wie bedeutsam diese Vorstellung von Freiheit und Selbstbestimmung für Stefan Andres war, wird auch ablesbar an dem Umstand, dass er zu Luises Streben nach Eigenständigkeit und Selbstverantwortung eine auffällige Parallele schafft in dem Verhalten der jugendlichen Protagonistin seines Romans „Die Liebesschaukel“ von 1951. (Anhang)
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil