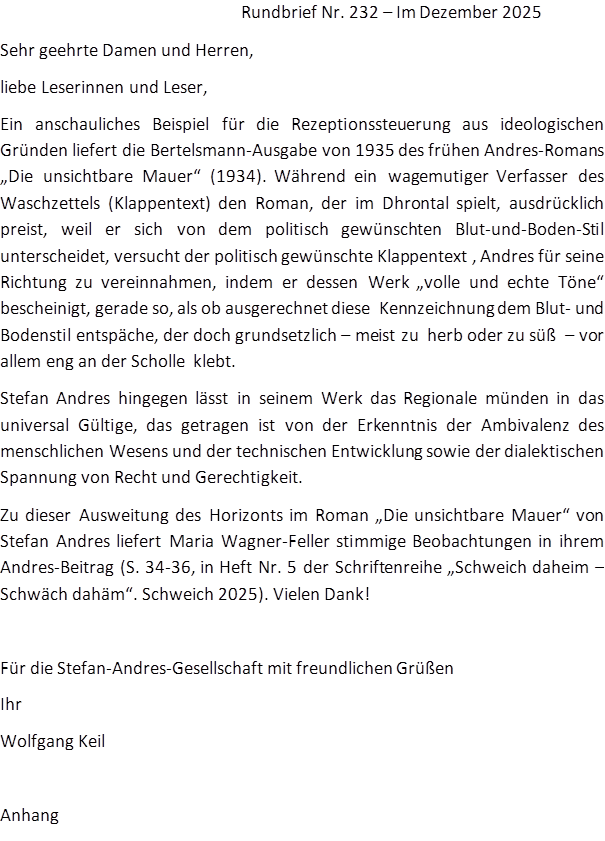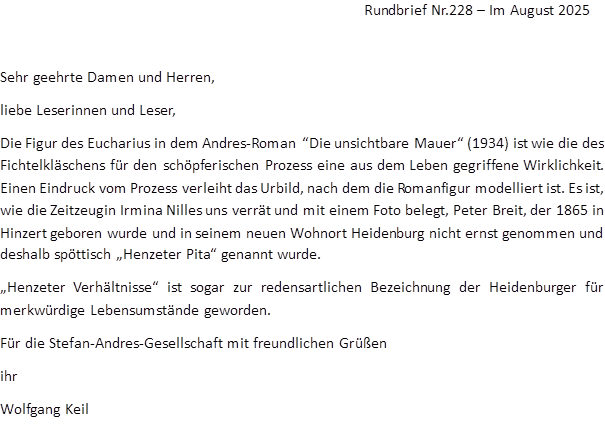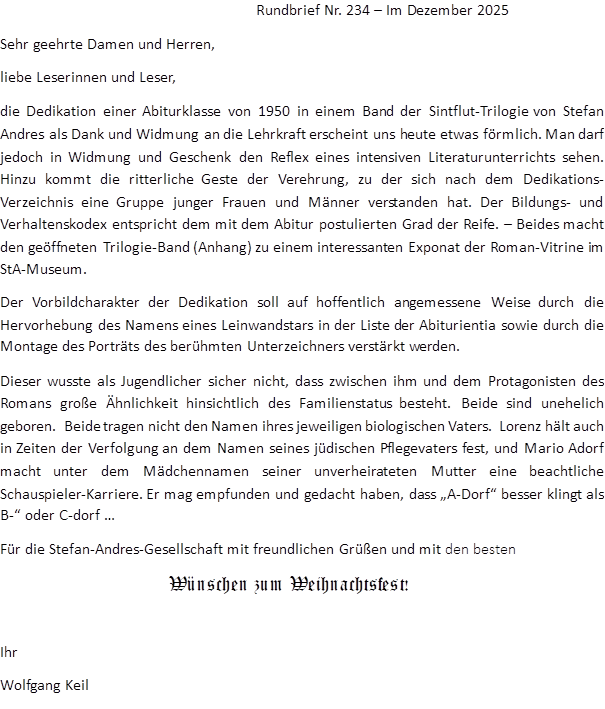
Autor: Berg-Schmitt
Rundbrief Nr. 233 – Im Dezember 2025
Rundbrief Nr. 232 – Einladung Geselliger Abend
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser!
Im Auftrag des Präsidenten der StAG, Dr. Ralf Hansjosten, sende ich Ihnen im Anhang den Flyer mit Informationen zur Einladung für unseren diesjährigen Geselligen Abend (musikalische Begleitung und Weinprobe) mit der politisch reizvollen Komödie, die in einem römisch-trierischen Haus um 400 nach Christus spielt und diesen gegen Zeus ausspielt. Der Eintritt ist frei – eine Anmeldung wird erbeten.
Ich wünsche eine angenehme Unterhaltung und sende freundliche Grüße
Ihr Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 231 – Im November 2025
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,
die im Heft Nr. 5 der Schriftenreihe „Schweich daheim – Schwäch dahäm“ von Petra Pauli verfasste „Buchvorstellung“ des Romans „Die Schuld der anderen“ von Gila Lustiger verdient ausdrückliche Erwähnung, weil Petra Pauli zusammen mit einem Porträt eine gefällige Präsentation einiger gewichtiger Werke der Stefan-Andres-Preisträgerin Gila Lustiger gelingt. Der notwendiger Weise sehr komprimierte Text der Verleihungs-Urkunde (Anhang) wird unterfüttert durch die hilfreiche Entfaltung der inhaltlichen Komplexität von Lustigers ausgesprochen informativem Gesellschaftsroman „Die Schuld der anderen“. (Berlin 2015).
Petra Pauli legt in ihrem Beitrag eine anregende Form der Rezeption vor. Besonders verdienstvoll daran ist die behutsame Einordnung des Lustiger-Romans „Die Schuld der anderen“ in das geistige Umfeld von Bertolt Brecht und Karl Marx. „Sorgt doch, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wart(d), sondern verlasst eine gute Welt“ („Die heilige Johanna der Schlachthöfe“, 1929/30.)
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 230 – Im Oktober 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
die Bereitschaft zur kritischen Prüfung überkommener Urteile ist eine immanent geforderte Grundhaltung der Andres-Anekdote um Tiberius und der Krechelromane „Sehr geehrte Frau Ministerin“ und „Landgericht“.
Andres‘ Anekdote um Kaiser Tiberius erscheint in sehr ähnlicher Form in Krechels Roman „Sehr geehrte Frau Ministerin“, in dem es wie bei Andres und in ihrem Roman „Landgericht“ um die Unzuverlässigkeit scheinbar verbürgter Weltentwürfe geht, die in ihrer platten Vereinfachung ohne die angemessene Berücksichtigung der Fakten auskommen. Über die jeweilige thematisch begründete Differenz parteiischer Zuschreibungen legt sich die Differenz von Objektivität und Subjektivität, von Fakt und Fiktion. In den beiden genannten Romanen von Ursula Krechel dominiert eine Skepsis, die über die Differenz von Fakt und „Fake“ (der persönlichen Vorstellungen, aber auch der wissenschaftlich verbürgten Tatsachenbehauptungen (in „Bibliotheken, Archiven, Biographien, Schriftrollen“) hinausreicht. Auch den sog. Quellen gegenüber ist daher Skepsis angebracht (Anhang).
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 229 – Im September 2025
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser!
Die geistige Nähe von Ursula Krechels Roman Landgericht zum Werk von Stefan Andres ist zu belegen durch die folgenden moralinfreien Zitate und die verblüffende Textkonvergenz (Anhang, ggf. Doppelklick nötig).
Die kühle analytische Reflexion der Entwicklung lässt im Opfer und Protagonisten den in seiner Absurdität monströsen Gedanken entstehen „er war Jude von Hitlers Gnaden gewesen“.
Bei einer so präzis und kühl arbeitenden sprachlichen und gedanklichen Sensibilität ist kein Platz für säuerliche Moralin-Sprüche und Anklagen. Und bei so bewandten Sachen, bei diesem hellhörig-spielerischen Umgang mit Sprache wird auch ein Gedankenreim möglich, mit dem skeptisch die Realität vorgeführt wird:
„Auch der Krieg war ja angeblich verloren,
aber niemand hatte ihn gefunden“.
Zitate nach Ursula Krechels Roman Landgericht, Salzburg 2012.
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 228 – Im August 2025
Rundbrief Nr. 227 – Im Juli 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Dorothee und Stefan Andres, Autor des frühen, etwas pathetisch „Heiliges Heimweh“ betitelten Romans,
haben in ihrem wechselhaften Leben einen hohen Begriff von dem entwickelt, was man unter “Heimat“
versteht.
Für die Stefan- Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Rundbrief Nr. 226 – Im Juni 2025
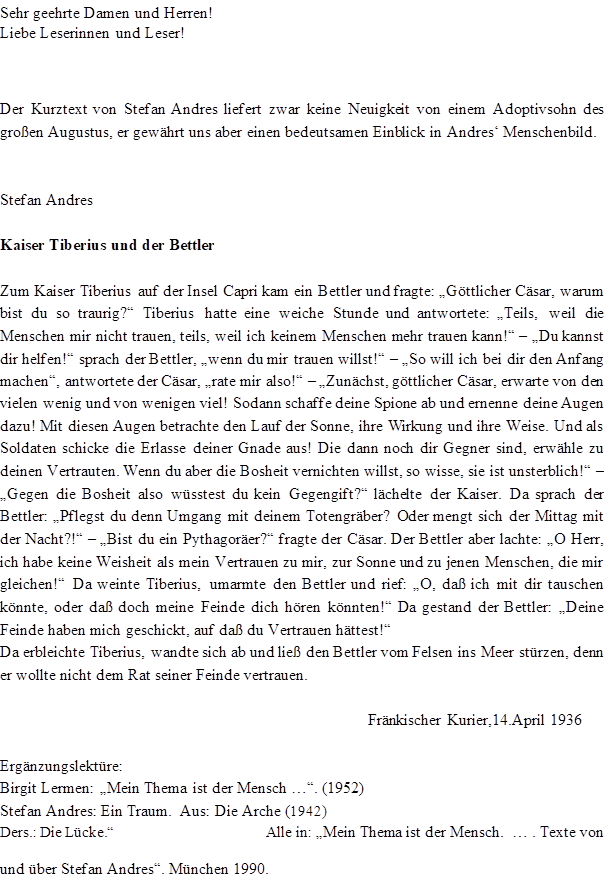
Anhang: Rundbrief Nr. 226
Rundbrief Nr. 225 – Im Mai 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
Die Impression „Das Fest der Fischer“ wurde, wie Dieter Richter, der Herausgeber des Editions-Bandes „Terrassen im Licht. Italienische Erzählungen“, anmerkt, 1938 von Stefan Andres verfasst. Die Schilderung einer Prozession erschien als eigenständiges Werk, wurde aber auch mit ihrer ganzen Aussagekraft von Andres in den Roman „Der Mann von Asteri (1939) integriert. Sie dient dort zur Verstärkung des Lokalkolorits und zur Illustrierung der Mentalität des Schauplatzes Città morta, zu dem der Schriftsteller das heute mondäne Bergstädtchen Positano im Roman umgewidmet hat.
Dort beginnt die Schilderung mit der Benennung des heidnisch anmutenden christlichen Festes: „Am folgenden Tag, am ersten Mai, feierte die Stadt Città morta die Eröffnung des Meeres.“ Die Magna Mater des Diesseits und die Stella Maris des Jenseits begegnen und versöhnen sich zum Wohl des Menschen in einem symbolischen Beschwörungsakt.
Als Stefan Andres !964 seinen ehemaligen Zufluchtsort erneut besucht, wird dort eine Filmsequenz zu Der Schriftsteller Stefan Andres. Stationen seines Lebens und Schaffens gedreht, die das Prozessionsritual ausführlich dokumentiert. Die Sequenz umfasst alle Komponenten eines kultischen Umzugs: die lokale, der Weg vom Dom zum Meer, die zeitliche, der Roman gibt den 1. Mai als Festtag an, die lautliche, man hört Kirchengesang, Glockengeläut und Böllerschüsse, die visuelle, im Zentrum der Prozession erscheint das feierlich getragene Altarbild der Madonna, und die soziale Komponente, dem hierarchisch geordneten Pilgerzug folgt ein lockeres Gedränge.
Im Film kommentiert der Schriftsteller das kultische Geschehen im O-Ton mit Erleichterung: „Ja, nichts hat sich geändert. Genau so steht’s in meinem Mann von Asteri beschrieben.“
Für die Stefan-Andres-Gesellschaft mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Keil
Anhang: Rundbrief Nr. 225