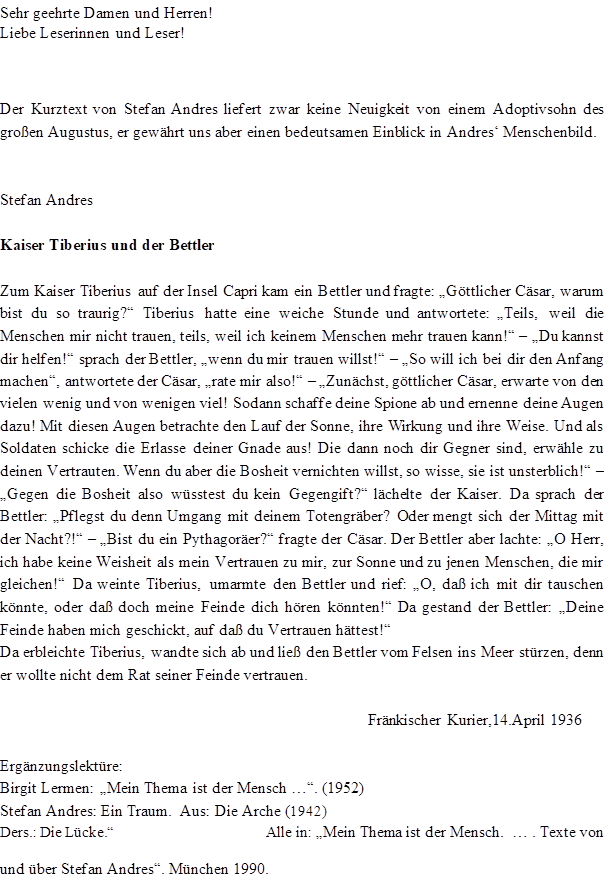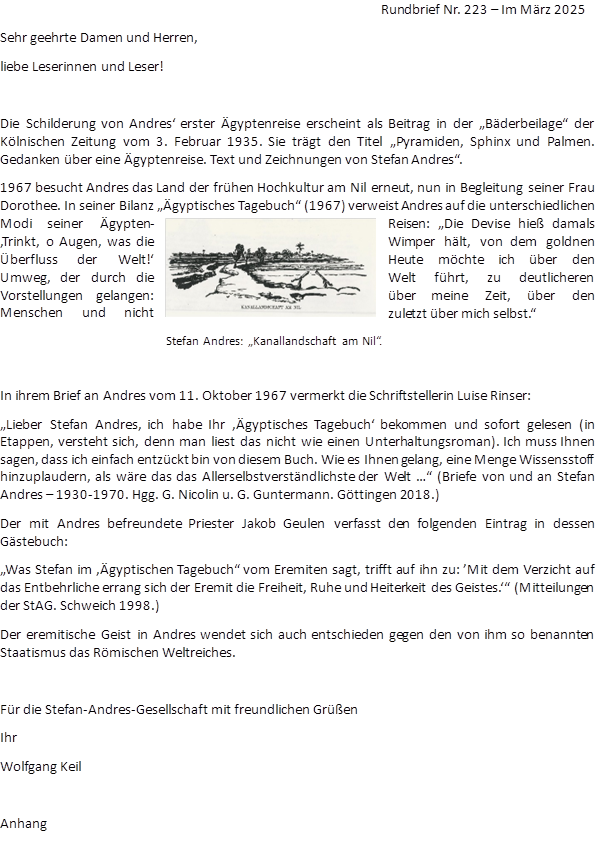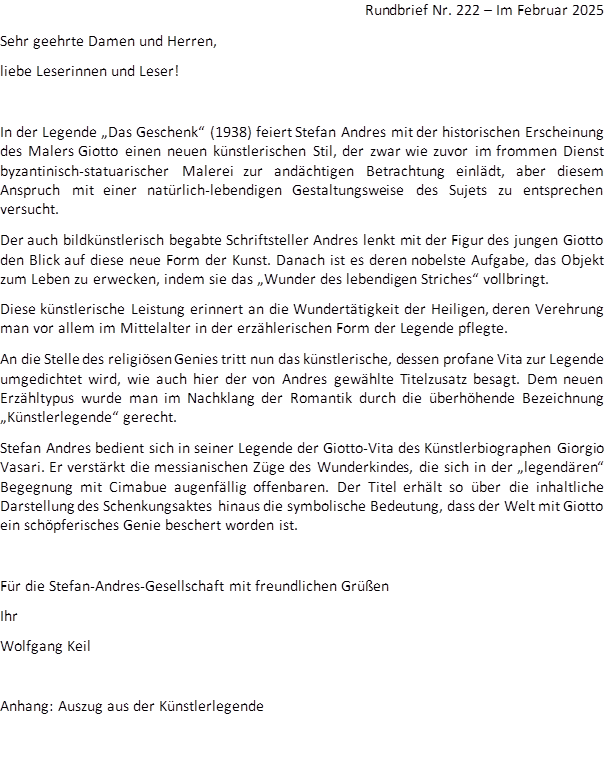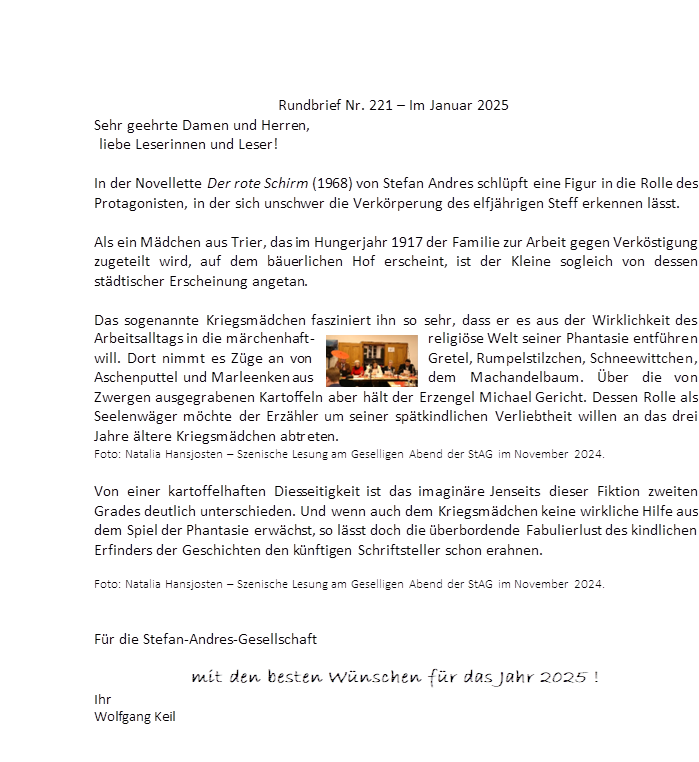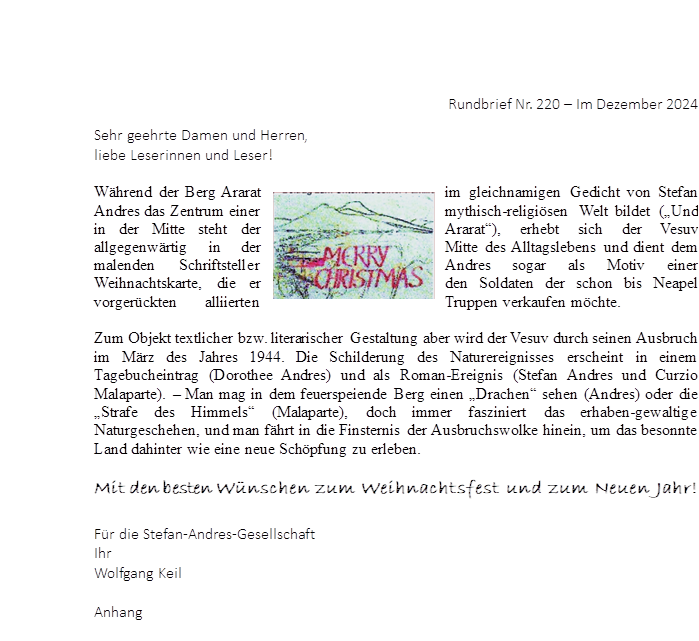Einladung
Die Stefan-Andres-Gesellschaft lädt ein zum diesjährigen Geselligen Abend
„Literatur und Weinkultur“
für Samstag, den 30. November, 18.00 Uhr, Seminarraum des Niederprümer Hofs in Schweich.
„Amors plötzliche Pfeile“
lautet das Thema, das Stefan Andres immer wieder in ernsten und heiteren Varianten bearbeitet.
Dass die Begegnung des jungen Menschen mit Eros-Amor in seinem Werk einen wichtigen Stellenplatz einnimmt, ist bedeutsam bei einem Autor, der, wie einige seiner Protagonisten, für ein geistliches Amt bestimmt ist. Und so verwundert es nicht, dass diese Bestimmung jeweils miterwähnt wird, wenn der geflügelte Knabe mit Pfeil und Bogen die Regentschaft antreten möchte und dadurch einen Konflikt zwischen Pflicht und Neigung hervorruft.
Die autobiographisch gearteten inneren und äußeren Auseinandersetzungen erfahren ihre Poetisierung durch ein gerüttelt Maß an Selbstironie.
Drei Episoden dieser Art sollen in szenischen Lesungen der Rezitatoren (E. Cannivé-Boesten, J. Hansjosten, C. Schött, R. Hansjosten, B. Hansjosten) zu Gehör gebracht werden. Es handelt sich um Auszüge aus Der Knabe im Brunnen (1953), Der rote Schirm (1968) und Bruder Luzifer (1933).
Horst Lachmund (Trier) und Emil Angel (Mondercange, Lux.) werden sich in selbstverfassten Beiträgen dem Thema annähern.
Die Lesungen sind eingebettet in eine Weinprobe des Schweicher Winzers Jürgen Schmitz vom Weingut Schweicher Hof. – Für die musikalische Untermalung wird Uschi Boes sorgen.
Der Eintritt ist frei.
Bitte um Anmeldung bei: andrekastner60@gmail.com – Tel.: 06502/937648 oder hansjosten-schweich@gmx.de – Tel.: 015902178529.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!